26. Mai 2021
Serie Gesundheitsdatenökosystem Teil 2: Die Autobahn des Gesundheitsökosystems
Ein funktionierendes Gesundheitsdatenökosystem braucht eine vernetzte Infrastruktur und gemeinsame Regeln. Auch wenn wir in der Schweiz für beides gewisse Ansätze haben, braucht es dringend weitere Massnahmen.
Um den gesellschaftlichen Nutzen eines Gesundheitsdatenökosystems freilegen zu können, sollte die Schweiz in sechs Bereichen vorwärts machen (Dazu mehr in Blogbeitrag 1). Die Massnahmen in diesen sechs Bereichen müssen aufeinander abgestimmt sein, weshalb eine kohärente Strategie eine Vorbedingung für ein erfolgreiches Vorgehen ist. Zwei der sechs Bereiche betreffen das Fundament eines Gesundheitsdatenökosystems: Es braucht eine gemeinsame Infrastruktur, mit der Daten erhoben, verarbeitet, gespeichert, geteilt und auch gelöscht werden können. Und es braucht gemeinsame Regeln und Vorstellungen über die Qualität, Technik sowie die ethischen Grundsätze, nach denen diese Infrastruktur genutzt wird. Deshalb drängt sich der Vergleich einer Autobahn auf.
Staat mit entscheidender Rolle
Wie eine Autobahn sollte die grundlegende Infrastruktur des
Gesundheitsdatenökosystems ebenfalls als öffentliches Gut gesehen werden.
Während bei einer Autobahn der übergeordnete Wert Mobilität ist, steigert das
Fundament des Gesundheitsdatenökosystems die öffentliche Gesundheit. Damit wird
bereits klar, dass bei dem Aufbau des Systems dem Staat eine entscheidende
Rolle zukommt. Nicht nur verfügt er über die Mittel und die Hoheit, ein solches
Fundament zu erstellen und zu verwalten. Sondern, das hat die Abstimmung über die
elektronischen Identifikationsdienstleistungen gezeigt, er geniesst auch das nötige
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger – was eine Grundvoraussetzung für das
Funktionieren des Systems ist. Das Fundament des Gesundheitsdatenökosystems
braucht also eine Organisation, die es führt und unterhält.
Desweiteren braucht es eine zweckdienliche Technologie, die
Plattform. Diese kann dezentral oder zentral ausgestaltet sein. Dabei gibt es
in der Schweiz bereits Pioniere, die in mögliche Technologien investiert und
Erfahrungen gemacht haben. Die Plattform midata.coop ist ein Beispiel. Die
Genossenschaft ermöglicht ihren Benutzern, Gesundheitsdaten in Apps hochzuladen
und selber zu verwalten. Die Plattformbetreiber garantieren die Sicherheit, die
Datenbesitzer entscheiden eigenständig, wem sie ihre Daten über die Plattform
anonymisiert zur Verfügung stellen wollen. Ein weiteres Beispiel ist das
elektronische Patientendossier. Auch dieses kann als eine Spur der Autobahn
gesehen werden. Dieses Bild zeigt aber auch, was der Anspruch sein muss an die
Infrastruktur. Der Nutzen steigt, wenn die Plattformen weiterentwickelt und mit
anderen vernetzt werden können. Eine Spur, die nicht an andere anschliessen
kann, ist eine Sackgasse. In der Digitalisierung des Gesundheitssystems
erfolgreiche Länder wie Finnland, Dänemark oder Israel haben vorgemacht, wie so
ein integriertes Fundament des Gesundheitsdatenökosystems umgesetzt werden kann.
Dabei haben staatliche und private Akteure zusammengearbeitet und den Aufbau-Prozess
von Beginn gemeinsam bestritten. Der dritte Punkt bei der Infrastruktur, neben
der orchestrierenden Organisation und der Technologie, sind gemeinsame
Standards und Regeln.
Gemeinsame Regeln und Standards nötig
Ein funktionierendes Gesundheitsdatenökosystem braucht
gemeinsame Regeln über Qualität, technische Standards und ethische Grundsätze.
Es braucht eine klare Vorstellung darüber, wie und mit was dieses System genutzt
werden kann – so wie es bei einer Autobahn Strassenverkehrs-Bestimmungen gibt.
Diese Regeln sind nicht nur wichtig für das Vertrauen der Akteure in das
System, also das Vertrauen darüber, dass es nicht missbraucht wird. Sondern die
gemeinsamen technischen und qualitativen Standards sind nötig, damit die
einzelnen Teilsysteme des Datenerhebens überhaupt miteinander verknüpft werden
können. Dass sie interoperabel sind. Auch hier wieder macht es Sinn, wenn sich
staatlich verordnete und freiwillige Initiativen ergänzen. Ein Schweizer
Beispiel ist das Swiss Personalized Health Network (SPHN). Ziel der Initiative
ist es, die «Grundlagen für den landesweiten Austausch von gesundheitsbezogenen
Daten zu schaffen». Es soll ein Netzwerk mit gemeinsamen Standards aufgebaut
werden, zurzeit sind es vor allem fünf Unispitäler, in dem Daten einheitlich
strukturiert und damit der Forschung zugänglich gemacht werden können.
Um diese gemeinsamen Standards durchzusetzen, sind
Zertifizierungsprozess nötig. Ähnlich wie durch die Motorfahrzeugkontrolle
(MFK) soll so sichergestellt werden, dass die gemeinsamen Standards im
Gesundheitsdatenökosystem hochgehalten werden, die Systeme interoperabel sind
und der gesellschaftliche Mehrwert von allen Akteuren voll genutzt werden kann.
Die zugrundeliegende technische Infrastruktur und die
gemeinsamen Regeln sind zwei von sechs Bereichen mit Handlungsbedarf. Die
weiteren vier sind Fachkräfte, Akzeptanz und Partizipation, Regulierung und
Anreize sowie Finanzierung und Investition. Diese werden wir in den kommenden
Tagen mit weiteren Blogartikel genauer beleuchten.
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
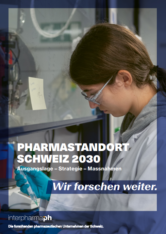








 PDF Deutsch
PDF Deutsch Im Webshop bestellen
Im Webshop bestellen