1. Juli 2021
Mit Zusammenarbeit zum Durchbruch
Möglicherweise ist der Pharmabranche der lang ersehnte Durchbruch im Kampf gegen Alzheimer gelungen. Am Beispiel vom Pharmakonzern Biogen mit internationalem Hauptsitz in der Schweiz kann dreierlei gut gezeigt werden: wie wichtig umfangreiche Investitionen in die Forschung sind, was für einen langen Atem Forscher brauchen und wie die gesamte Gesellschaft von der engen Zusammenarbeit zwischen der akademischen Welt und der Industrie profitieren kann.
Alzheimer ist
für forschende Pharmaunternehmen ein besonders schwieriger Gegner. Gefühlt gab
es in drei Jahrzehnten Forschung und Entwicklung gegen die Krankheit vor allem
Rückschläge zu verzeichnen – zwischen 1998 und 2017 gab es 146 erfolglose
Versuche, ein Medikament gegen die häufigste Form von Demenz zu entwickeln. Gleichzeitig
leiden weltweit fast 50 Millionen Menschen an Alzheimer und anderen Formen von Demenz
und jährlich kommen 10 Millionen Neuerkrankte dazu. In der Schweiz leben heute
rund 145’000 Menschen mit Demenz und die Zahl wird Schätzungen zu Folge bis 2050
auf bis zu 315’000 Personen ansteigen. Entsprechend hohe Wellen schlug die
Nachricht von der (an Auflagen gebundenen) Zulassung eines neuen Alzheimer-Medikaments
durch die US-Arzneimittelbehörde FDA. Es ist die erste neue Alzheimer-Arznei
seit fast 20 Jahren und die erste und bisher einzige Behandlung, welche die der
Alzheimer-Krankheit zugrunde liegenden Pathomechanismen beeinflusst.
Geduld ist alles
Im Kampf gegen Alzheimer wird es noch viele weitere Studien brauchen. Das
Sammeln von Evidenz braucht viel Zeit. Überhaupt gilt: Für die Erforschung und
Entwicklung von Medikamenten braucht es nicht nur umfangreiche Investitionen,
sondern auch einen sehr, sehr langen Atem. Im Schnitt dauert die Entwicklung
eines einzigen neuen Wirkstoffs rund 12 Jahre und führt zu Ausgaben von rund
2.5 Milliarden Franken. Gleichzeitig schafft es von 10’000 getesteten
Substanzen im Durchschnitt eine einzige (!) bis zur Zulassung.
Das Beispiel Hepatitis C zeigt, dass der Weg zum Erfolg lang und
schwierig ist: Erste Medikamente galten als schwer verträglich, die
Behandlungsdauer betrug 48 Wochen und die Heilungsrate betrug bescheidene 41%.
Erst nach 20 Jahren intensiver Forschung gelang 2011 der Durchbruch – mit
Medikamenten der neusten Generation dauert eine Behandlung heute noch 8 bis 12
Wochen und die Erfolgsrate beträgt 95%.
Auch Scheitern ist Fortschritt
Wir sollten daher keine Angst vor dem Scheitern haben, denn auch ein
gescheiterter Versuch bringt zusätzliche Erkenntnis: «Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail
again, fail better» (Samuel Beckett). Das ist das Mindset forschender
Pharmaunternehmen und es ermöglicht bahnbrechende Innovationen. Ebenso
unverzichtbar sind allerdings die finanziellen Investitionen, um Jahrzehnte der
Forschung und Entwicklung zu ermöglichen. Diese Mittel können nur
wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen aufbringen. Ohne Erfolg fehlen die
Mittel für Investitionen, was wiederum Innovation erschwert.
Erst gute Standortbedingungen und ein guter Schutz des geistigen
Eigentums ermöglichen es, Innovationen zu wagen. Der generierte Umsatz fliesst wiederum
in die Entwicklung neuer Arzneimittel – und kommt damit der gesamten
Gesellschaft zugute: Vielen Patientinnen und Patienten kann geholfen werden, Behandlungskosten
fallen weg, Menschen können im Arbeitsmarkt verbleiben und die Sozialsysteme werden
entlastet.
Erfolgreiche Schweizer
Innovationszusammenarbeit
Kritiker entgegnen oft, dass die Gesellschaft über Krankenkassenprämien
und über Steuern (für Forschungsausgaben an Hochschulen und Universitäten)
zweimal für Medikamente zahle. Das erweist sich bei näherer Betrachtung als
haltlos, wie etwa am Beispiel des neuen Biogen-Wirkstoffs gegen Alzheimer
gezeigt werden kann.
Insgesamt kamen von den Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der
Schweiz in Höhe von 22.9 Mrd. CHF im Jahr 2019 rund 2/3 aus der
Privatwirtschaft. Mit einem Anteil von über 40% an den Ausgaben für die
Grundlagenforschung, beteiligt sich die Privatwirtschaft auch massgeblich an
der Erarbeitung von neuem Wissen. Die Pharmaindustrie ist der grösste private
Investor in Forschung und Entwicklung in der Schweiz und trägt rund ein Drittel
der gesamten privaten Investitionen.
Der neue Wirkstoff gegen Alzheimer entstammt einem Forschungsprojekt
der Universität Zürich und wurde vom Spin-off Neurimmune entwickelt. Das
Biotechnologieunternehmen Biogen, welches 1978 in Genf von einer kleinen Gruppe
visionärer Wissenschaftler, darunter auch der Schweizer Charles Weissmann und
die späteren Nobelpreisträger Walter Gilbert und Phillip Sharp, gegründet
wurde, lizenzierte die Therapie 2007 von Neurimmune und wird den Wirkstoff zukünftig
im solothurnischen Luterbach produzieren. Wie der Tages
Anzeiger berichtete, ist die Universität als Inhaberin eines wichtigen
Patents über eine Lizenzvereinbarung prozentual am Gewinn des Herstellers
Biogen beteiligt. Über solche Lizenzvereinbarungen mit Spin-offs und
Pharmaunternehmen fliesst somit investiertes Geld an die öffentliche Hand zurück.
Diese Aufgabenteilung bzw. enge Zusammenarbeit zwischen Privaten und der öffentlichen Hand im Bereich Forschung und Innovation ist eine historisch gewachsene Schweizer Erfolgsgeschichte. Ist nun tatsächlich der ersehnte Durchbruch im Kampf gegen Alzheimer gelungen, ist es ein weiteres Beispiel für den erfolgreichen Transfer akademischer Forschung in die Praxis und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und der Privatwirtschaft.
Für einen
erfolgreichen und wettbewerbsfähigen Innovationsstandort Schweiz ist diese
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Akademie, Start-Ups / Spin-Offs und
der forschenden Pharmaindustrie ein absolutes Schlüsselelement, weil sie die
Stärken aller Akteure verbinden kann. Diese Erfolgsgeschichte gilt es
weiterzuschreiben!
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
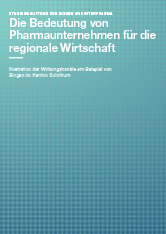


 Im Webshop bestellen
Im Webshop bestellen





 PDF Deutsch
PDF Deutsch