28. Oktober 2020
Serie Gesundheitswesen Schweiz 1/3: Wie die Qualität unseres Gesundheitswesens durch Forschung laufend noch weiter gesteigert wird
Das Schweizer Gesundheitswesen wird geschätzt: Über 80 Prozent der Bevölkerung haben einen sehr oder eher positiven Eindruck von der Gesamtsituation. Trotzdem sind Kostendiskussionen immer wieder ein Auslöser für Unmut. Warum Sparmassnahmen oft kontraproduktiv sind – und ein verstärkter Fokus auf Qualität und Forschung die Lösung sein kann.
Das Gesundheitsmonitoring 2019 war in seine Aussage eindeutig: Die Zufriedenheit
mit dem Schweizer Gesundheitssystem bleibt sehr hoch. 86 Prozent der Befragten
waren sehr oder eher zufrieden – und das trotz starkem medialem Fokus auf die
hohen Gesundheitskosten. Die Schweizer Stimmberechtigen scheinen Qualität und
Quantität des Gesundheitswesens höher zu gewichten als Kostenüberlegungen. Klar
abgelehnt wurden daher gemäss der Studie Einschränkungen oder Experimente zur
Kostendämpfung, die eine Minderung der Qualität im Gesundheitssystem zur Folge
hätten.
Hohe Zufriedenheit
trotz emotionaler Kostendebatte
Der grosse Zuspruch zum Gesundheitssystem scheint widersprüchlich zur aktuellen
politischen Debatte rund um die Gesundheitsausgaben. Denn Fakt ist auch, dass
die Zunahme der Gesundheitskosten in Form von höheren
Krankenversicherungsprämien für viele Familien ein reelles Problem darstellen. Wenn
von Kosten in Milliardenhöhe die Rede ist, führt das schnell zu Unverständnis.
In Folge wird die Debatte emotional und mit hoher medialer Aufmerksamkeit
geführt.
Bei allen berechtigten Sorgen um die Kosten darf aber die Zufriedenheit
mit der Qualität des Gesundheitswesens nicht ignoriert werden. Statt diese mit
voreiligen Sparprogrammen zu torpedieren, sollte die Debatte versachlicht
werden. Nicht die blossen Zahlen sind für die Diskussion relevant, sondern die
Wirkung dieser Investitionen und deren Beitrag zu einer gesunden Schweiz.
Statt abstrakter Summen sollte über die Effizienz diskutiert werden
Health Technology Assessments (HTAs), prüfen genau diese Wirkung und
helfen damit die Kostendiskussion zu versachlichen. Sie bezeichnen die systematische
Bewertung von Gesundheitstechnologien und Organisationsstrukturen, in denen
medizinische Leistungen erbracht werden. HTAs können auf der Ebene des
Gesundheitssystems eine wichtige Kosten-Nutzen-Abwägung leisten, die die Kosten
aus einer gesamt-gesellschaftlichen Sicht betrachten und neben medizinischen
und ökonomischen Themen auch ethisch-moralische und volkswirtschaftliche
Fragestellungen miteinbeziehen. Damit können sie helfen, die teils abstrakten
Summen, die oft genannt werden, in ein besseres Verhältnis zu stellen und zu
erklären.
Auch das Bundesamt für Gesundheit führt HTAs durch, berücksichtigt den
gesamt-gesellschaftlichen Blickwinkel jedoch oft zu wenig. Denn der Fokus liegt
derzeit hauptsächlich auf Arzneimittelkosten, obwohl diese nur 12.1 Prozent der
Gesundheitskosten ausmachen und eine Prüfung auf Wirtschaftlichkeit bereits
Teil der Preis- und Tarifsetzungen ist. Es wäre daher wünschenswert, wenn bei
HTAs ein breiterer und ausgeglichener Themenfokus berücksichtigt werden würde
und auch volkswirtschaftliche Fragestellungen konsequent miteinbezogen werden.
Mehr Effizienz durch konsequenten Fokus auf Qualität
Einen stärkeren Fokus auf Qualität fordert auch die «allianz q». Der Think Tank fordert, dass konsequent Qualitätsverbesserungen angestrebt werden, statt kurzfristige Sparmassnahmen ins Zentrum der Bemühungen zu stellen. Denn das könnte die Schweiz einmal teuer zu stehen kommen.
Interdisziplinäre Fachgruppen leisten zudem einen wichtigen Beitrag zur
Effizienz- und Qualitätssteigerung. Denn eine verstärkte Zusammenarbeit im
Gesundheitswesen sorgt dafür, dass Gelder effizienter investiert werden und die
Qualität gesteigert wird. Aus diesem Grund engagiert sich Interpharma zum
Beispiel gemeinsam mit andern Gesundheitsakteuren im sogenannten «Do-Tank»
santeneXt. Er treibt interdisziplinäre Innovationen voran und setzt sich dafür
ein, dass die Schweizer Bevölkerung möglichst schnell davon profitieren kann.
Pharmazeutische Forschung als Innovationstreiber für Qualität
Ein wichtiger Innovationstreiber ist auch die pharmazeutische Forschung.
Sie trägt massgeblich dazu bei, dass das Gesundheitswesen effizienter wird und die
Qualität noch weiter gesteigert werden kann. In letzter Zeit haben es beispielswese
viele hochwirksame Arzneimittel bis zur Marktreife geschafft und konnten damit beachtliche
Fortschritte bei der Behandlung verschiedener Krankheiten erzielen. Exemplarisch
stehen dafür zum Beispiel die Zell- und Gentherapien.
Diese Innovationen helfen damit in hohem Masse dabei, Kosten zu senken.
Sie verkürzen den Heilungsprozess und verursachen weniger Nebenwirkungen.
Patienten werden so schneller wieder gesund und können schneller wieder ihrem Erwerbsalltag
nachgehen. Auch wenn ein qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem also
zunächst teurer erscheint, hilft es, Pflegeaufwand und Aufenthaltsdauer zu
reduzieren und schliesslich gesamtgesellschaftlich Kosten zu sparen. Daher ist
es wichtig, dass Investitionen in ein qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem
als effiziente Kostensenkungsstrategien verstanden werden.
Unüberlegte
Sparrunden blockieren die Wirkung von Innovation
Innovative Entwicklungen können jedoch erst dann ihre effizienzsteigernde
Wirkung entfalten, wenn sie allen zur Verfügung stehen. Eine einseitige
Kostenfokussierung ist daher gefährlich. Denn sie führt zwangsläufig zu einer
Zweiklassenmedizin, in der nur jene Patienten von Innovationen profitieren, die
sich Zusatzleistungen finanzieren können. Das verhindert jedoch, dass das
gesellschaftliche Potential von medizinischen Innovationen wirklich genutzt werden
kann.
Die Qualität
der Gesundheitsversorgung muss im Zentrum stehen
Angesichts
der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und der technologischen Durchbrüche ist
eine Kostendiskussion im Schweizer Gesundheitswesen unausweichlich. Doch ein unreflektierter Fokus auf Sparrunden im
Gesundheitswesen wird dem Bedürfnis der Gesellschaft nicht gerecht. Stattdessen
muss eine gesellschaftliche Diskussion unter Einbezug wissenschaftlicher,
ökonomischer, sozialer und ethischer Aspekte geführt werden, die langfristige
Lösungen liefert.
Deutlich wird dabei, dass die
Qualität der Gesundheitsversorgung und der Patientennutzen im Zentrum stehen
muss. Denn Investitionen in die qualitative Weiterentwicklung hilft nicht nur
der Gesundheit von Patienten, sondern am Ende auch beim Senken der Kosten im
Gesundheitswesen.
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
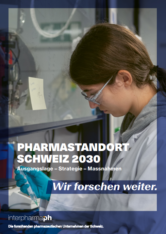








 PDF Deutsch
PDF Deutsch Im Webshop bestellen
Im Webshop bestellen