26. November 2020
Serie Arzneimittel 3/3: Mehr als ein Wirkstoff: Auch wie Medikamente verabreicht werden ist relevant
Tablette, Spritze oder Salbe? Und in welcher Dosis? Es gibt viele Möglichkeiten, wie medizinische Wirkstoffe verabreicht werden können. Alle werden getestet und zugelassen. Aber darf sich ein Arzt über diese Vorgaben hinwegsetzen? Was dann passiert – und warum das manchmal unausweichlich ist.
Es kommt nicht nur auf den Wirkstoff an: Die Wirkung eines
Medikaments kann sich je nach Form des Präparats, sowie nach Altersgruppe und
Geschlecht zum Teil deutlich unterscheiden. Auch die Hilfs- und Zusatzstoffe
sind oft unterschiedlich und können die Aufnahme des Wirkstoffs beeinflussen
oder Nebenwirkungen auslösen. Bei der Darreichungsform sind Innovationen daher ebenfalls
wichtig.
Die Darreichungsform
kann die Lebensqualität verbessern
Darreichungsform und Dosierung sind ein wichtiger Aspekt von
patientenorientierter Medizin. Innovative und auf den Patienten abgestimmte
Ansätze können einen grossen Unterschied machen und die Lebensqualität stark
verbessern.
Ein Beispiel dafür ist die Medikation von Multipler
Sklerose. Dank intensiver Forschung gibt es heute auch Arzneien, die in
Tablettenform für eine orale Einnahme ausgelegt sind und nicht mehr wie früher
gespritzt werden müssen. Das Resultat ist eine höhere Therapiezufriedenheit und
insgesamt eine bessere Lebensqualität. Diese Art der Innovation ist daher ebenfalls
enorm wichtig und entsprechend zu honorieren.
Zulassung durch
Swissmedic als Grundlage
Welche Darreichungsform am geeignetsten ist, entscheiden
Ärzte aufgrund der Krankengeschichte und Diagnose des Patienten und anderen
persönlichen Faktoren. Die Grundlage dafür bildet stets die Zulassung durch
Swissmedic. Sie garantiert, dass Medikamente erst eingesetzt werden, wenn sie
ausreichend auf ihre Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität geprüft worden sind.
So können potenziell gefährliche Nebenwirkungen ausgeschlossen werden.
Es kann jedoch passieren, dass ein Arzneimittel für die
Anwendung (noch) nicht zugelassen wurde. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Beispielsweise, weil die Gruppe der Patienten zu klein ist, um eine
aussagekräftige Studie durchführen zu können. Das ist bei sogenannten Orphan
Drugs, Arzneimitteln für sehr seltene Krankheiten, manchmal der Fall. Manche
Arzneimittel können zudem nicht für Kinder zugelassen werden, weil Studien an
Kindern ethisch nicht vertretbar sind.
Off-lable Use als
Ausnahmefall
Das heisst nicht, dass diese Arzneimittel unter diesen
Umständen nicht genutzt werden dürfen. Denn im Rahmen der Therapiefreiheit
können Ärzte ein Medikament gegen eine schwere Krankheit ohne Zulassung
verschreiben, das einen grossen Therapienutzen verspricht und für das es keine
Alternative gibt. Wenn es für die Anwendung noch nicht zugelassen ist, wird
dies «Off-Lable Use», oder unlizenzierter Gebrauch genannt. Diese Bezeichnung
gilt auch für Arzneimittel, die zur Behandlung eines Leidens eingesetzt werden,
für das es offiziell nicht zugelassen wurde.
«Off-lable Use» ist keine Seltenheit und kann manchmal der richtige Weg sein. Bei der Behandlung von Neugeborenen muss in über der Hälfte der Fälle auf Medikamente zurückgegriffen werden, die nicht offiziell zugelassen werden konnten, da entsprechende Studien nur schwer möglich sind. Bei Erwachsenen sind noch 25 Prozent der Verabreichungen «off-lable». Die Verantwortung wird dabei durch den Arzt getragen, der die Medikamentensicherheit prüft und eine Verordnung stets gut begründet.
Unter «Off-lable-use» ist jedoch nie eine Selbstmedikation
zu verstehen: Medikamente dürfen nur eingenommen werden, wenn sie von einem
Arzt explizit für die Behandlung verschrieben wurden.
Keine Willkür bei der
Finanzierung
Die Finanzierung von Arzneimitteln im «Off-Lable-Use» durch
Krankenversicherer ist leider nicht einheitlich gelöst. Denn Versicherer sind lediglich
verpflichtet, die Kosten für jene Arzneimittel zurückerstatten, die auf der Spezialitätenliste
stehen. Wird ein Arzneimittel verwendet, das nicht für diese Behandlung auf der
Spezialitätenliste zu finden ist, regelt der Artikel 71a-d der
Krankenversicherungsverordnung (KVV), wie es zu vergüten ist. Die Regelung soll
damit Patienten, die auf eine nicht zugelassene Therapie angewiesen sind, vor
einer willkürlichen Rückvergütung schützen.
Medikamentensicherheit
ist immer im Vordergrund
Die Medikamentensicherheit steht immer im Fokus. Es wird
alles getan, damit ein Medikament sicher ist und die erwünschte Wirkung die
Nebenwirkungen übertreffen. Für die Behandlung ist dabei nicht nur der
Wirkstoff, sondern auch die Darreichungsform ein wichtiger Aspekt. Ebenso wie
der Wirkstoff selbst, sollten daher Innovationen in der Darreichungsform
geschätzt und gefördert werden.
Innovative Behandlungen stehen jedoch nicht von Anfang an
allen Patienten zur Verfügung. Denn um die Sicherheit des Medikaments zu
gewährleisten, müssen Arzneimittel zugelassen sein. Das letzte Wort hat jedoch
der Arzt bzw. die Ärztin. Denn sollte ein Medikament die grössten
Heilungschancen aufweisen, das (noch) nicht für die spezifische Behandlung
zugelassen wurde, so kann es dennoch «off-lable» verabreicht werden. Es ist
aber wünschenswert, dass möglichst alle Patienten geregelt mit innovativen
Therapien behandelt werden können und nicht nur Ausnahmefälle.
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
 weiterlesen
weiterlesen
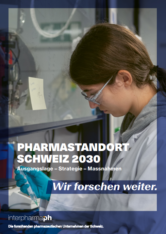







 PDF Deutsch
PDF Deutsch Im Webshop bestellen
Im Webshop bestellen